#28 - Viele Leitlinien, eine Meta-Analyse und eine Studie voller Schimpfwörter
Lust auf mehr Evidenz für dein Team?
Alle Infos zur Fortbildung Ergo-Modelle für die Praxis gibt es hier!
Die beiden Studien aus dieser Folge:
Westwood, S. J., Aggensteiner, P.-M., Kaiser, A., Nagy, P., Donno, F., Merkl, D., Balia, C., Goujon, A., Bousquet, E., Capodiferro, A. M., Derks, L., Purper-Ouakil, D., Carucci, S., Holtmann, M., Brandeis, D., Cortese, S., Sonuga-Barke, E. J. S., European ADHD Guidelines Group (EAGG), Baeyens, D., … Wong, I. C. (2025). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Psychiatry, 82(2), 118.
Hasslinger, J., D’Agostini Souto, M., Folkesson Hellstadius, L., & Bölte, S. (2020). Neurofeedback in ADHD: A qualitative study of strategy use in slow cortical potential training. PloS one, 15(6), e0233343.
Alle weiteren Studien und Artikel aus dieser Folge:
Fransen J. (2024). There is No Supporting Evidence for a Far Transfer of General Perceptual or Cognitive Training to Sports Performance. Sports medicine, 54(11), 2717–2724.
Ghadamgahi Sani, N., Akbarfahimi, M., Akbari, S., Alizadeh Zarei, M., & Taghizadeh, G. (2022). Neurofeedback Training Versus Perceptual-motor Exercises Interventions in Visual Attention for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Controlled Trial. Basic and clinical neuroscience, 13(2), 215–224.
Hasslinger, J., Bölte, S., & Jonsson, U. (2022). Slow Cortical Potential Versus Live Z-score Neurofeedback in Children and Adolescents with ADHD: A Multi-arm Pragmatic Randomized Controlled Trial with Active and Passive Comparators. Research on child and adolescent psychopathology, 50(4), 447–462.
Lam, S. L., Criaud, M., Lukito, S., Westwood, S. J., Agbedjro, D., Kowalczyk, O. S., Curran, S., Barret, N., Abbott, C., Liang, H., Simonoff, E., Barker, G. J., Giampietro, V., & Rubia, K. (2022). Double-Blind, Sham-Controlled Randomized Trial Testing the Efficacy of fMRI Neurofeedback on Clinical and Cognitive Measures in Children With ADHD. The American journal of psychiatry, 179(12), 947–958.
Willer, L., Treusch, Y. & Möckel, L. (2023). Neurofeedback-Therapie bei Kindern mit AD(H)S in der ergotherapeutischen Praxis: Ergebnisse einer retrospektiven, monozentrischen Studie. Ergoscience 18(4), 149-156.
Zanona, A. F., Piscitelli, D., Seixas, V. M., Scipioni, K. R. D. D. S., Bastos, M. S. C., de Sá, L. C. K., Monte-Silva, K., Bolivar, M., Solnik, S., & De Souza, R. F. (2023). Brain-computer interface combined with mental practice and occupational therapy enhances upper limb motor recovery, activities of daily living, and participation in subacute stroke. Frontiers in neurology, 13, 1041978.
00:00:15 Alltagsgeschichten: Hühner, Katze und tierische Erlebnisse
Sara Mohr und Sarah Bühler eröffnen die Folge mit persönlichen Geschichten aus ihrem Alltag. Sarah erzählt, wie ihre drei Hühner das Familienleben bereichern, aber auch den Garten beanspruchen. Sara berichtet von einer Nachbarskatze, die sie vorübergehend aufgenommen hat, und beschreibt, wie beruhigend das Zusammensein mit Tieren sein kann. Beide reflektieren, dass Tiere im Alltag für Entspannung und Freude sorgen können.
00:10:41 Themenvorstellung: Neurofeedback in der Ergotherapie
Nach dem tierischen Einstieg leitet Sara das Hauptthema ein: Neurofeedback. Sie erklärt, dass viele Hörer*innen sich dieses Thema gewünscht haben und sie selbst zunächst skeptisch war, da Neurofeedback oft als Allheilmittel dargestellt wird. Sarah bringt erste Praxiserfahrungen ein und betont, dass es verschiedene Protokolle und Geräte gibt. Beide machen deutlich, dass Neurofeedback eine Unterform des Biofeedbacks ist: Während beim Biofeedback verschiedene Körperfunktionen (z. B. Puls, Hautleitwert) visualisiert werden, misst Neurofeedback die Hirnaktivität mittels EEG.
00:14:41 Neurofeedback und Biofeedback: Grundlagen und Praxis
Sara erläutert die Funktionsweise von Biofeedback und Neurofeedback: Durch die Visualisierung von Körper- bzw. Hirnfunktionen lernen Klient*innen, gezielt Strategien zur Regulation einzusetzen. Ziel ist es, diese Strategien später auch ohne Gerät im Alltag anzuwenden. Neurofeedback misst dabei Hirnaktivität und gibt Rückmeldung über einen Bildschirm.
00:15:11 Evidenz in Leitlinien: Indikationen und Empfehlungen
Sara recherchiert, in welchen Leitlinien Neurofeedback aktuell empfohlen wird:
Rehabilitation nach Schlaganfall (Armparese): Studien zeigen gemischte Ergebnisse. Hochfrequentes Training (mindestens 20 Minuten täglich, 5 Tage/Woche) kann in Kombination mit intensivem Armtraining wirksam sein, ist aber sehr aufwendig. Die Leitlinie spricht keine eindeutige Empfehlung aus.
Aufmerksamkeitsstörungen nach neurologischen Erkrankungen (Erwachsene): Keine ausreichende Evidenz für eine Empfehlung.
Tumorbedingte Fatigue: Unklare Studienlage, keine eindeutige Empfehlung.
Zwangsstörungen bei Kindern/Jugendlichen: Studien zeigen mögliche Effekte, aber nur bei Erwachsenen untersucht – daher keine Empfehlung für Kinder/Jugendliche.
Autismus-Spektrum-Störung: Für komorbide Sprachentwicklungsverzögerung wird Neurofeedback explizit nicht empfohlen, da negative Effekte auf die Sprachentwicklung nachgewiesen wurden. Für soziale Interaktion und kognitive Fähigkeiten gibt es keinen nachgewiesenen Nutzen.
ADHS (Kinder ab 6 Jahren): Neurofeedback kann ergänzend eingesetzt werden, wenn standardisierte Protokolle verwendet werden. Die Leitlinie empfiehlt mindestens 25–30 Sitzungen und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit. Transfer in den Alltag soll durch lerntheoretische Prinzipien und Transferübungen unterstützt werden.
00:26:17 Aktuelle Studienlage: Systematisches Review und Metaanalyse zu ADHS
Sara stellt eine aktuelle Metaanalyse (2025) zu Neurofeedback bei ADHS vor. Insgesamt wurden 53 randomisiert-kontrollierte Studien mit knapp 2.500 Teilnehmenden ausgewertet. Die meisten Studien zeigten ein hohes Risiko für Verzerrungen, etwa durch fehlende Verblindung. Die Ergebnisse:
Standardisierte Protokolle zeigen etwas bessere Ergebnisse als nicht-standardisierte, aber der Unterschied ist gering.
Vergleich mit medikamentöser Behandlung: Medikamente (z. B. Methylphenidat) sind Neurofeedback in der Wirksamkeit deutlich überlegen.
Vergleich mit Bewegung oder kognitivem Training: Kein Unterschied in der Reduktion der ADHS-Symptomatik.
Fazit: Nach Jahrzehnten der Forschung gibt es keine überzeugende Evidenz, dass Neurofeedback anderen Behandlungsverfahren bei ADHS überlegen ist.
00:39:12 Qualitative Studie: Strategien und Compliance beim Neurofeedback
Sara stellt eine qualitative Studie (2020) vor, in der 30 Kinder und Jugendliche mit ADHS nach ihren Strategien beim Neurofeedback befragt wurden. Die wichtigsten Ergebnisse:
Kognitive Strategien: Fokussierung, innere Bilder, Gedächtnisabruf, Motivation, Gedankenvermeidung, Wachheitsregulation.
Emotionsregulation: Nutzung positiver oder starker Emotionen, Achtsamkeit, emotionale Gedanken.
Physiologische Strategien: Atemregulation, Muskelspannung, sehr still sitzen.
Unspezifische Strategien: Passivität, Disengagement, Experimentieren, fehlende Einsicht.
Die Studie zeigt, dass Kinder mit hoher Compliance vor allem kognitive und Emotionsregulationsstrategien nutzen. Kinder mit niedriger Compliance setzen eher auf physiologische Strategien oder zeigen wenig Engagement. Ein zentrales Problem: Viele Kinder verstehen nicht, wie sie das Neurofeedback tatsächlich beeinflussen können, was die Motivation und den Alltagstransfer erschwert.
00:54:54 Transfer in den Alltag und Bedeutung für die Ergotherapie
Sara und Sarah diskutieren, wie wichtig es ist, Neurofeedback in eine betätigungsorientierte Therapie einzubetten. Der Alltagstransfer gelingt nicht automatisch – Therapeut*innen müssen gezielt daran arbeiten, dass die im Neurofeedback erlernten Strategien auch im Alltag anwendbar werden. Dazu gehört auch die Einbindung von Eltern, Lehrkräften und Bezugspersonen. Die Hosts betonen, dass Neurofeedback keine klassische Ergotherapie ist, aber als ergänzendes Verfahren sinnvoll sein kann, wenn der Transfer aktiv gestaltet wird.
00:58:12 Drei Do’s für die Praxis
Zum Abschluss fassen Sara und Sarah drei zentrale Empfehlungen zusammen:
Verweist Klient*innen mit Neurofeedback-Verordnung an spezialisierte Praxen mit entsprechender Expertise.
Nutzt nur Geräte und Protokolle, die den Leitlinienempfehlungen entsprechen (standardisierte Protokolle).
Betont die Einbettung in eine betätigungsorientierte Therapie und gestaltet den Alltagstransfer aktiv mit.
01:01:43 Abschluss und Ausblick
Die Hosts laden die Community ein, eigene Erfahrungen und Fragen zu Neurofeedback zu teilen. Sie weisen auf die Kommentarfunktion auf ihrer Website und auf eine kommende Fortbildung hin. Abschließend betonen sie, dass die Studienlage zu Neurofeedback weiterhin kritisch zu betrachten ist und der Alltagstransfer im Fokus stehen sollte.
(Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI generiert.)
Die Studie in Bildern
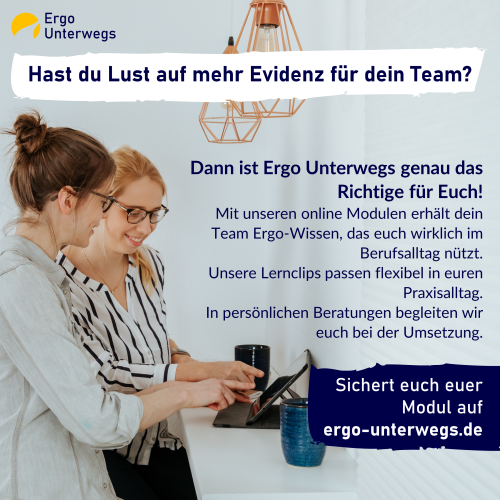
Leave a comment
Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.