#29 - Warum soll ich mir etwas wünschen, das ich nicht kann?
Betätigungswünsche können ein positiver Start in die Therapie sein! Aber es kann auch gute Gründe geben, warum eine Person solche Wünsche (zunächst) nicht äußert. Die heute Studie beschäftigt sich mit Betätigungswünschen von älteren Menschen, die zu Hause Alltagsunterstützung erhalten.
Geschichten aus dem Alltag: Sarah beobachtet hüpfende Hühner und Sara das Gras beim Wachsen.
Lust auf mehr Evidenz für dein Team?
Die Studie aus dieser Folge:
Granbom, M. (2025). Structured assessments on the desire for activities – ‘Why wish for what I can’t do?’. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 32(1), 2483505.
Infos zum Occupational Gaps Questionnaire:
Hier gibt es die aktuelle Version auf der Homepage der Entwicklerinnen zu kaufen.
Und hier gibt es einen kostenlosen Einblick.
00:00:23 Alltagsgeschichten: Garten, Hochbeete und Hühner
Sara Mohr und Sarah Bühler starten die Folge mit persönlichen Geschichten aus ihrem Alltag. Sarah berichtet von der Neugestaltung ihres Gartens, der im letzten Jahr von den Hühnern zerstört wurde. Sie erzählt, wie sie Staudenbeete anlegt und dabei darauf achtet, nur ungiftige Pflanzen für die Hühner zu wählen. Die Herausforderung besteht darin, die Hühner mit Zäunen von den Beeten fernzuhalten. Sara berichtet von ihren Hochbeeten auf dem Balkon, dem Anziehen von Pflanzen und wie ihr das Gärtnern aktuell Freude und Entspannung bringt. Beide reflektieren, wie solche Betätigungen den Alltag bereichern und Wohlbefinden fördern.
00:06:45 Rückmeldungen zur letzten Folge: Neurofeedback
Bevor das neue Thema startet, greifen Sara und Sarah Rückmeldungen zur vorherigen Folge über Neurofeedback auf. Sie diskutieren eine Hörerinnenzuschrift, die das Thema Masking bei Autismus anspricht: Das bewusste Einsetzen von neurotypischem Verhalten kann zwar belastend sein, aber auch als Skill genutzt werden, wenn Betroffene dies gezielt und selbstbestimmt einsetzen. Eine weitere fachliche Rückmeldung hebt hervor, dass Neurofeedback auf der Ebene der Hirnwellenmuster arbeitet und nicht direkt die Teilhabe adressiert. Die Hosts betonen, dass Teilhabe am besten durch gezielte Förderung von Teilhabe verbessert wird und Neurofeedback eher eine ergänzende Maßnahme zur Arbeit an Körperfunktionen ist.
00:12:07 Themenvorstellung: Betätigungswünsche
Sara leitet das Hauptthema der Folge ein, das durch eine Instagram-Umfrage ausgewählt wurde: Betätigungswünsche. Sie fragt Sarah nach einem eigenen aktuellen Betätigungswunsch, woraufhin Sarah vom Wunsch erzählt, mit dem Hund Stand Up Paddling auszuprobieren. Die Hosts nutzen dies als Einstieg, um die Bedeutung von Betätigungswünschen für Motivation und Zielsetzung in der Ergotherapie zu verdeutlichen.
00:13:20 Betätigungswünsche in der ergotherapeutischen Praxis
Im Praxisalltag ermitteln Sara und Sarah Betätigungswünsche und -anliegen meist über Tagesprofile oder Assessments wie COPM, OSA oder COSA. Sie betonen, wie wichtig es ist, nicht nur Probleme, sondern auch Wünsche und die dahinterliegenden Bedeutungen zu erfragen. Oft steckt hinter einem geäußerten Anliegen (z. B. Autofahren) ein tieferliegendes Bedürfnis wie Unabhängigkeit oder soziale Teilhabe. Die gezielte Nachfrage nach der Bedeutung hilft, alternative Betätigungen zu finden, falls die ursprüngliche Aktivität nicht mehr möglich ist.
00:16:12 Studienbesprechung: „Why wish for what I can’t do?“
Sara stellt eine aktuelle Studie aus Schweden vor, die sich mit Betätigungswünschen älterer Menschen im Homecare-System beschäftigt. Die Forscherin nutzte den Occupational Gaps Questionnaire, bei dem Teilnehmende angeben, welche Aktivitäten sie aktuell ausführen und welche sie sich für die Zukunft wünschen. Die Studie zeigt, dass viele ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf überraschend wenige Betätigungswünsche äußern.
00:28:04 Ergebnisse der Studie: Gründe für fehlende Betätigungswünsche
Die Auswertung der Interviews ergab drei Hauptgründe, warum Betätigungswünsche selten geäußert wurden:
Kosten: Viele Aktivitäten sind mit Ausgaben verbunden, sei es für die Aktivität selbst oder für Assistenz. Die Teilnehmenden verzichten häufig aus finanziellen Gründen auf bestimmte Wünsche.
Körperliche Einschränkungen: Viele Betätigungen erscheinen aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr realistisch. Die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst, ob ein Wunsch überhaupt entsteht.
Strukturelle Rahmenbedingungen: Die Teilnehmenden haben gelernt, dass das Unterstützungssystem (Homecare) nur begrenzte Möglichkeiten bietet. Wünsche, die als unerfüllbar wahrgenommen werden, werden oft gar nicht mehr geäußert.
Ein weiterer zentraler Punkt: Wenn Wünsche geäußert wurden, bezogen sie sich häufig auf das gemeinsame Tun mit anderen – nicht auf Selbständigkeit, sondern auf soziale Teilhabe.
00:35:05 Reflexion: Bedeutung von Selbständigkeit und Teilhabe
Sara und Sarah diskutieren, dass Selbständigkeit nicht für alle Klient*innen das wichtigste Ziel ist. Für manche ist das Erleben von Kontrolle oder das gemeinsame Tun entscheidend. Sie stellen Metaphern und Methoden aus der handlungsorientierten Diagnostik und Therapie (HODT) vor, wie z. B. die „Schnur mit Perlen“, um im Gespräch die individuellen Kerne einer Betätigung sichtbar zu machen. Sie betonen, dass es legitim ist, Hilfe anzunehmen und dass Teilhabe auch mit Unterstützung möglich ist.
00:40:31 Altersaspekte: Wünsche und emotionale Bedeutung
Die Hosts greifen auf, dass mit steigendem Alter Betätigungswünsche oft kleiner und emotional bedeutsamer werden. Langfristige, aufwendige Aktivitäten wie Reisen verlieren an Bedeutung, während kleine, alltagsnahe und sozial-emotionale Betätigungen wichtiger werden. Das Aufgeben von Wünschen kann auch ein Coping-Mechanismus sein, um Enttäuschungen zu vermeiden.
00:42:18 Strukturelle Beschränkungen und der „Horizont der Möglichkeiten“
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass institutionelle Rahmenbedingungen den „Horizont der Möglichkeiten“ der Klient*innen einschränken. Wenn Unterstützungssysteme dauerhaft überlastet sind, werden Wünsche gar nicht mehr wahrgenommen oder geäußert. Die Hosts diskutieren, wie wichtig es ist, trotzdem nach Wünschen zu fragen, um langfristig Versorgungssysteme zu verbessern.
00:45:04 Fazit: Wünsche ernst nehmen und Zeit geben
Sara und Sarah fassen zusammen, dass das Erfragen von Betätigungswünschen ein zentraler Bestandteil ergotherapeutischer Arbeit ist. Wünsche werden oft nicht spontan geäußert, sondern müssen gemeinsam erarbeitet werden. Es braucht Zeit, Raum und manchmal kreative Gesprächsführung (z. B. Wunderfrage), um verborgene Wünsche sichtbar zu machen. Sie ermutigen Ergotherapeut*innen, mehr über Wünsche und Wunder zu sprechen und verabschieden sich mit einem Ausblick auf die nächste Folge.
(Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI generiert.)
Die Studie in Bildern
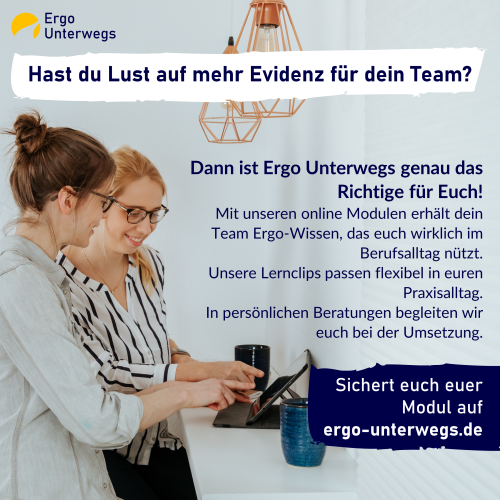
Leave a comment
Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.